Im Antlitz die Geschichte
8. Oktober 2010 | von Armin Stingl | Kategorie: Der besondere BeitragDas Nathanstift feiert heuer sein 100-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlaß wird Alfred Nathan, der bedeutende Wohltäter Fürths, gewürdigt – mit einem farbenfrohen Mosaik aus Gesichtern gebürtiger »Nathanier«. Am 23. Oktober 2010 um 11 Uhr wurde das Mosaik im Eingangsbereich der neuen Frauenklinik enthüllt. Außerdem erschien ein Buch mit Beiträgen der ehemaligen Stadtheimatpflegerin Barbara Ohm und anderen. Mein eigener Text spiegelt im Folgenden den Blick des Grafikers auf das Projekt.
Vorgeschichte
Im Jahr 2007 zeigte das Jüdische Museum Franken eine von der Nathanstiftung geförderte Ausstellung mit dem Titel »Andere Umstände«. »Am Beispiel des vor hundert Jahren gegründeten Nathanstifts«, hieß es im Einführungstext, »nähert sich die Sonderausstellung den Themen Schwangerschaft und Geburt im Spiegel jüdischer und christlicher Traditionen und kontrastiert sie mit den Neuerungen des medizinischen Zeitalters. In einem zweiten Teil erinnert die Ausstellung an die jüdische Stifterfamilie Nathan: ›Andere‹, durch den Nationalsozialismus eingeleitete ›Umstände‹, zwingen die letzten Familienmitglieder 1938 in die Emigration.«
Um die Bedeutung der Nathanstiftung für Fürth plastisch zu veranschaulichen, wurde eine ca. fünf Meter breite, zwei Meter hohe Rundwand mit Abbildungen derjenigen gebürtigen Nathanstiftler eingerichtet, die dem Aufruf des Museums gefolgt waren und ihre Babyfotos eingesandt hatten. »Die meisten Bilder erreichten das Jüdische Museum Franken aus Fürth und Umgebung, einige aus Australien, den USA, Israel und England. Darunter sind auch Bilder jüdischer Bürger, die Deutschland aufgrund nationalsozialistischer Verfolgung verlassen mußten. Schwarze Leerstellen auf der Fotowand stehen für die jüdischen ›Nathanianer‹, die im Nationalsozialismus deportiert und ermordet wurden.«
Gemeinsam mit dem Architekturbüro Koch erhielt ich den Auftrag zur Gestaltung der Ausstellung. Für die Präsentation der Fotos wählte ich ein Raster aus quadratischen Modulen, die sowohl für hoch- als auch querformatige Bilder geeignet sind. Eine andere Möglichkeit wäre zum Beispiel eine »simulierte« Pinnwand gewesen, die aber – abgesehen davon, daß sie sehr viel mehr Arbeit bedeutet hätte – womöglich einen zu bunten, zu chaotischen Eindruck erweckt hätte. Wegen der extrem unterschiedlichen technischen Qualität der Fotos verzichtete ich ferner auf eine originalgetreue Wiedergabe und glich sie einander an, indem ich sie in Schwarzweiß umwandelte, mit einem dunklen Farbton einfärbte und mit einem passenden hellen hinterlegte. Der Fotowand wurde ein Karteikasten beigestellt, der Name, Geburtsdatum, Reproduktionen der unverfremdeten Fotos und schriftliche Anmerkungen der Einsender enthielt.
Bei einem Ausstellungsbesuch wurde diese Fotowand vom Chefarzt der Frauenklinik Dr. Hanf und Herrn Salimi von der Öffentlichkeitsarbeit als dekorative Möglichkeit (dekorativ im positiven Sinn) für den Neubau der Frauenklinik entdeckt.
Grafische Umsetzung
Diese neue, völlig andere Raumsituation im künftigen Eingangsbereich machte allerdings einige Veränderungen erforderlich. Es galt dort eine sechs mal sieben Meter große Wand in ihrer gesamten Fläche zu bespielen. Die meisten der Fotos würde man nicht mehr bequem in Augenhöhe betrachten können; bei einem Betrachtungsabstand von zehn Metern würde man von den oft vor viel Hintergrund abgelichteten Personen dann nichts mehr erkennen.
Ich erhöhte die Seitenlänge der Module von 12 auf 30 cm, legte den Fokus auf die Gesichter und wählte einen drei- bis vierfach überlebensgroßen Ausschnitt. Zur besseren Integration des Mosaiks in die Wandfläche und um dem erschlagenden Eindruck eines riesigen Tafelbildes entgegenzuwirken, rückte ich die Bilder etwas auseinander und ließ in unregelmäßigen Abständen Leerstellen, die sich zum Rand hin häufen und eine Ausdünnung des Motivs bewirken sollen. Somit verwandelten sich nun diejenigen Stellen, die ich im Jüdischen Museum als Platzhalter für die ermordeten »Nathanier« geschwärzt hatte in – wenn man so will – das glatte Gegenteil: Leerstellen, die darauf warten, von künftigen Generationen eingenommen zu werden. Suchte man eine übers Praktische hinausgehende Interpretation, wäre das eine schöne, philanthropische Lesart; ausschlaggebend für die weißen Löcher waren aber tatsächlich rein ästhetische Erwägungen.
Weil eine Zuordnung von Fotos und Namen mit einem zusätzlichen Karteikasten »in situ« nicht möglich war, versah ich die Bilder dezent mit Namen und Geburtsdatum. Außerdem würde eine »Legende« in Augenhöhe angebracht werden, die eine Zuordnung, wenn auch leider mit einer gewissen Anstrengung, ermöglicht. Etwaige Titel ließ ich stillschweigend, aber mit voller Absicht weg: kein Mensch wird als Doktor oder Professor geboren; ebenso unterschlug ich das Sterbedatum derjenigen, die nicht mehr unter uns weilen: Niemand sollte an diesem Ort, der seine Existenz dem Werden und Geborenwerden verdankt, die glanzlose Rückseite der Medaille sehen müssen.
Wie schon bei der »Museumswand« waren die Fotos technisch gesehen oft von – zwangsläufig – minderer Qualität. Auch diesmal wandelte ich alle Bilder in schwarzweiß um und ließ außerdem über die scharfen, also die »zu brillanten«, einen Unschärfe-Filter laufen, damit sie sich nicht allzu sehr von den unscharfen unterschieden. Zusätzlich erhöhte ich diesmal den Kontrast und versah sie mit einem extrem groben Raster, der sich allerdings – je weiter man sich davon entfernt – optisch in ein Halbtonbild »zurückverwandelt«. Diesen »Trick« habe ich übrigens bei ähnlich problematischen Materiallagen schon öfter angewendet, noch nie aber als konstituierendes Stilmittel. Auch hatte ich bisher noch nie aus einem scharfen Foto – aus ästhetischen Gründen wohlgemerkt! – ein unscharfes gemacht.
Um einen lebendigen, optimistischen Eindruck zu evozieren, ersetzte ich Schwarz und Weiß durch Pastelltöne und kräftige Töne aus dem jeweils gleichen Farbspektrum. Dabei mußte der Kontrastabstand einerseits groß genug sein, um das Motiv deutlich hervortreten lassen, andererseits klein genug, um eine monochrome grüne, blaue, rote usw. Farbfläche zu erzielen.
Ein (Kunst)Werk ohne Künstler
Es gibt vieles, was mir an diesem Auftrag sehr gefallen hat. Am meisten die gleichsam organische Entstehungsweise dieser »Arbeit«, wie man so etwas im Kunstjargon nennt – vorausgesetzt, es stammt von ausgewiesener Künstlerhand. Am Anfang stand bei diesem Projekt eben nicht die Frage: Hier haben wir eine leere Wand, außerdem müssen wir noch ein bißchen Geld für »Kunst am Bau« ausgeben – was machen wir damit?
Mit noch soviel Hirnschmalz und kreativem Brainstorming hätte man keine bessere Idee entwickeln können. Sie ist so einfach wie genial und ich scheue mich, sie überhaupt als Idee zu bezeichnen: Die Verbindung des Orts mit jenen Menschen, die aus ihm hervorgegangen sind. Denn genau darin besteht ja seine Aufgabe: Lauter muntere kleine Fürther in die Welt zu setzen...
Die konkrete Herstellung des Mosaiks folgte im Grunde lauter simplen Notwendigkeiten. Eine Menge kleiner, hauptsächlich formaler Entscheidungen hat zu einem ganz bestimmten, im Rückblick geradezu zwangsläufigen Ergebnis geführt:
Ganz am Anfang stand die Idee von Daniela Eisenstein, der Leiterin des Jüdischen Museums: Eine Visualisierung, um die Bedeutung des Stifts zu veranschaulichen; dann die geistige Transferleistung, die Fotowand »zweckentfremdet« einzusetzen; weiterhin die Anpassung an die neue Raumsituation und zu guter Letzt die architektonische Umsetzung durch Andreas Pietsch, der mir übrigens nicht nur bei den technischen, sondern auch bei allen gestalterischen Detailfragen zur Seite stand.
Es kommt mir fast so vor, als wäre das Mosaik wie von selbst entstanden und ich hätte seiner Entstehung lediglich beigewohnt, vergleichbar der wohlwollenden Begleitung und Beobachtung eines Kindes (oder anderen Lebewesens), das, obzwar sein Ursprung durch eine minimale Aktion gesetzt sein mag, im Großen und Ganzen doch aus sich selbst heraus wächst und gedeiht.
Eine Menge Menschen – eine Menschenmenge
Die altbackenen und frischen Väter, die werdenden und gewordenen Mütter, die Besucher werden hier von einer regelrechten Menschenmenge begrüßt, der es offensichtlich gelungen ist, das Licht der Welt zu erblicken und die sich, wie man an den Bildern der Älteren sieht, zumindest eine gewisse Zeit lang erfolgreich in ihr behauptet hat. Trifft man normalerweise auf derartige Reihungen von Namen und Gesichtern, hat man es meist mit Dingen zu tun, die weniger erfreuliche Gefühle in uns hervorrufen: mit Kriegerdenkmälern, Holocaust-Gedenkstätten und existentiellen, mitunter schockierenden Kunstwerken, zum Beispiel denen von Christian Boltanski. Immer liegen ihnen Ereignisse zu Grunde, bei denen viele Menschen ums Leben gekommen sind, meist im gleichen Atemzug, oft als namen- und schicksalslose, entindividualisierte Opfer eines Unglücks oder Verbrechens. Ich hoffe ehrlich, daß diese Ansammlung von Gesichtern keine derartigen, sondern ausnahmsweise einmal nur positive Gefühle hervorruft.
216 Menschenbilder blicken einem entgegen, Menschen, die, wenn sie alle einmal zu Personen geworden sind, hoffentlich ihr Potential auszuschöpfen vermochten bzw. in Zukunft noch vermögen. Weiteren 92 Porträts begegnet man in den Gängen und Wartebereichen der Frauenklinik, allerdings in kleinen, leichter überschaubaren Gruppen. Der Eindruck dort wird sicher ein anderer sein, ein sehr viel individuellerer.
Melancholische Schlußbetrachtung
Den Foto-Einsendungen war oft eine kurze Notiz beigelegt, die ich teils mit Rührung gelesen habe (»Hier ein Bild, als ich noch jung und schön war.«). Wenn mich bei der Arbeit am Computer ein Gesicht aus dem Monitor heraus anstrahlte, lächelte ich unwillkürlich zurück. Manchmal spürte ich aber auch eine gewisse Wehmut.
Es kommt nicht oft vor, daß man als – wie man früher sagte – Gebrauchsgrafiker, der hauptsächlich Produkte gestaltet, die nach einer Woche im Papierkorb landen oder bald schon wieder aus dem Netz verschwunden sind, die Gelegenheit erhält, an etwas Beständigerem mitzuwirken, an etwas, das einen womöglich selbst überleben wird. Schließlich bestehen die einzelnen Mosaikteile aus 2 mm starkem Stahlblech und einer 1 mm dicken Emaille-Schicht – lichtecht, säurefest, alles in allem unverwüstlich, sofern man sie nicht mit einem Hammer mutwillig zerstört. Wenn sie nicht irgendwann einmal eingestampft und eingeschmolzen werden, könnten sie ohne weiteres die momentane Menschheit überdauern und – wenn man den Gedanken weiterspinnt – von einer künftigen entdeckt werden, der die Tafeln zu allerlei Spekulationen Anlaß geben könnten. (»Sind die etwa wegen dieser merkwürdigen rasterförmigen Pocken ausgestorben?«)
Nichts währt ewig. Ich für meinen Teil tröste mich mit der Phantasie, daß ausgerechnet die Tafel mit meinem eigenen Konterfei in hundert Jahren im Freizeitkeller jenes Handwerkers landet, der mich – aus Gründen, die ich mir heute noch nicht vorstellen mag – abmontiert hat, dem ich jedoch zu schade zum Wegschmeißen war. Mein Antlitz wäre womöglich noch verschönert von einer Patina oder einem Craquelé-Effekt, der von den Pfeilen herrührt, die beim Spickern daneben gegangen sind...
Armin Stingl ist Freier Graphiker, Fürther aus Leidenschaft und selbst ein »Nathanier«.

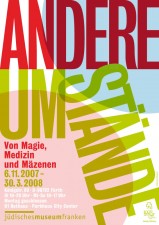







Der Verein Medien PRAXIS e.V. dreht derzeit eine TV-Dokumentation zum 100-jährigen Bestehen des Nathanstifts. Die Entstehung des beschriebenen Mosaiks kommt darin auch vor. Obwohl der Ausstrahlungstermin der Programmvorschau zu entnehmen sein wird, darf ich hier schon den Sonntag, den 31. Oktober 2010 als geplanten Termin der Erstausstrahlung verraten...
Nachtrag vom 3. Dezember 2010:
Der knapp halbstündige Film ist ist inzwischen im Handel erhältlich, Bezugsquellen siehe hier.
Während Julia Thomas und Thomas Steigerwald von der Medien PRAXIS derzeit intensiv an ihrem Dokumentarfilm über die Geschichte des Nathanstifts arbeiten, suche ich als ihr gewähltes Vereinsoberhaupt fieberhaft nach einem/einer an der Medienarbeit interessierten Vorstands-Kollegen/-Kollegin. Näheres dazu führe ich im Blog der Medien PRAXIS aus...
Pressespiegel: »Die Frauenklinik ist bezugsfertig« (FN)
Pressespiegel: »300 Gesichter fürs Nathanstift« (FN)
Pressespiegel: »Das Nathanstift und seine Kinder« (FN)
[...] den Namen Nathanstift tragen. Für den Eingangsbereich hat der Grafiker Armin Stingl ein Fotomosaik entworfen. Der Film portaitiert den Menschen Alfred Nathan und sein segensreiches Handeln für die Stadt Fürth und [...]
Pressespiegel: »Ein Film über das Nathanstift« (FN)
Pressespiegel: »Glückliche ‘Geburt’« (Stadt Fürth)
Pressespiegel: »Mit dem kleinen Leon ist die 1000er-Marke geknackt« (FN)
Pressespiegel: »Kulturwandel im Klinikum« (FN)